Beruf: Kornschösser
Leberecht
Jahr, aus dem der Begriff stammt: 1550
Region, aus der der Begriff stammt: Torgau, Sachsen
was ist ein "Kornschösser"?
(siehe Link, Hans Kronberger:
http://books.google.de/books?id=XcwU...page&q&f=false )
Marlies
ein Schösser ist 1) ein Steuereinnehmer, oder 2) im bäuerlichen Bereich ein Knecht, der den Dünger besorgt
DeutschLehrer
Auch Grimms Wörterbuch erklärt den Schösser als Steuereinnehmer:
SCHOSSER,SCHÖSSER, m.1) einnehmer des schosses, steuereinnehmer, rentmeister, mhd. schoჳჳer mhd. wb. 2, 2, 176b. LEXER mhd. handwörterb. 2, 683: Bastian Wulner, schosser zu Jhenne (1497). MICHELSEN spec. cod. diplom. Jenensis (Jena 1852) 15; dem schosser zu Gotha. quelle von 1528 bei DIEF.-WÜLCKER 844; später mehr und mehr durch die umgelautete form verdrängt: schöszer, receptor, rentmeister SCHOTTEL 1408; geiziger, ungerechter schöszer, quaestor rapax et injustus STIELER 1789; schösser, dispensator, quaestor STEINBACH 2, 497; schösser, einnehmer der herrschafftlichen einkünfte FRISCH 2, 221b; abgesehen von der eigentlichen bedeutung bezeichnet schösser auch andere beamtete personen, so besonders den amtsvertreter: amtmann, amtsverweser, schöszer. STIELER 339, vgl. WEISZE kom. opern 1 (1771), 146 ff.; schösser, eine amtspersohn. FRISCH 2, 221c. auf bäuerliche verhältnisse übertragen: der schosser, knecht, welcher auf der alpe den dünger besorgt; der gschoszner, helfer des melkers SCHM. 2, 478; belege: schösser und dergl. amtleut. reichs-pol. ordn. 1530, XIX, 5; und als er ins schössers haus kam. LUTHER 2, 644a; der schösser zu Alstet. 3, 138a; er war selbst (kurfürst Friedrich) schösser, nach Claus Narren rath, der sagte einmal zu jm, da der hertzog klagte, er hette kein geld, werde ein schösser oder rentmeister, sprach er, so kriegestu auch geld. tischreden (1568) 344b (vgl. KIRCHHOF wendunm. 3, 70 Österley); vitzthom, pfleger, verwalter, schösserBd. 15, Sp. 1601
und amptleut. FISCHART Garg. 269b; schrieb derowegen dem schösser allda. SCHWEINICHEN 1, 245; den aufenthalt eines amtmanns oder schössers, welcher die ehemals hieher flieszenden zinsen und gefälle noch fernerhin einnimmt. GÖTHE 39, 265; seit dem vom römischen volk kein schosz mehr gefordert ward, war auch der eigentlichste theil des amts der schösser weggefallen. NIEBUHR röm. gesch.3 1, 464;
ein weisze mausz, war sein mundschenck,
ein aff, sein schösser wolgelenck.
ROLLENHAGEN froschm. F 1b;
schösser, die in ämtern dienen.
LOGAU 2, 241, 194;
ist es kein superintendent,
so mags ein küster seyn,
und ists kein schösser der mich kennt,
so mags ein schreiber sein.
WEISE cur. gedanken s. 7. 2) schosser, die bäckerschaufel, womit die bäcker den geformten teig in den ofen schieben (schieszen); s. schosse 1. schöszer PFISTER 267. 3) schösser, hänfling, s. schösserlein. 4) schosser, schösser, spielkügelchen der kinder (s. schusser) FRISCH 2, 221c; mit schössern, hinckers, löpers. COMENIUS sprachenth. (1657) 941; eine schachtel mit schossern für die kinder. GÖTHE an Knebel 227. schosser, schossers PFISTER 267.
Leberecht
Da es in diesem alten Buch ja als etwas "besonderes" eingetragen ist, nehme ich an, dass es sich bei diesem Schösser tatsächlich um eine Art Steuereinnehmer handeln muss.
Leberecht
Jahr, aus dem der Begriff stammt: 1550
Region, aus der der Begriff stammt: Torgau, Sachsen
was ist ein "Kornschösser"?
(siehe Link, Hans Kronberger:
http://books.google.de/books?id=XcwU...page&q&f=false )
Marlies
ein Schösser ist 1) ein Steuereinnehmer, oder 2) im bäuerlichen Bereich ein Knecht, der den Dünger besorgt
DeutschLehrer
Auch Grimms Wörterbuch erklärt den Schösser als Steuereinnehmer:
SCHOSSER,SCHÖSSER, m.1) einnehmer des schosses, steuereinnehmer, rentmeister, mhd. schoჳჳer mhd. wb. 2, 2, 176b. LEXER mhd. handwörterb. 2, 683: Bastian Wulner, schosser zu Jhenne (1497). MICHELSEN spec. cod. diplom. Jenensis (Jena 1852) 15; dem schosser zu Gotha. quelle von 1528 bei DIEF.-WÜLCKER 844; später mehr und mehr durch die umgelautete form verdrängt: schöszer, receptor, rentmeister SCHOTTEL 1408; geiziger, ungerechter schöszer, quaestor rapax et injustus STIELER 1789; schösser, dispensator, quaestor STEINBACH 2, 497; schösser, einnehmer der herrschafftlichen einkünfte FRISCH 2, 221b; abgesehen von der eigentlichen bedeutung bezeichnet schösser auch andere beamtete personen, so besonders den amtsvertreter: amtmann, amtsverweser, schöszer. STIELER 339, vgl. WEISZE kom. opern 1 (1771), 146 ff.; schösser, eine amtspersohn. FRISCH 2, 221c. auf bäuerliche verhältnisse übertragen: der schosser, knecht, welcher auf der alpe den dünger besorgt; der gschoszner, helfer des melkers SCHM. 2, 478; belege: schösser und dergl. amtleut. reichs-pol. ordn. 1530, XIX, 5; und als er ins schössers haus kam. LUTHER 2, 644a; der schösser zu Alstet. 3, 138a; er war selbst (kurfürst Friedrich) schösser, nach Claus Narren rath, der sagte einmal zu jm, da der hertzog klagte, er hette kein geld, werde ein schösser oder rentmeister, sprach er, so kriegestu auch geld. tischreden (1568) 344b (vgl. KIRCHHOF wendunm. 3, 70 Österley); vitzthom, pfleger, verwalter, schösserBd. 15, Sp. 1601
und amptleut. FISCHART Garg. 269b; schrieb derowegen dem schösser allda. SCHWEINICHEN 1, 245; den aufenthalt eines amtmanns oder schössers, welcher die ehemals hieher flieszenden zinsen und gefälle noch fernerhin einnimmt. GÖTHE 39, 265; seit dem vom römischen volk kein schosz mehr gefordert ward, war auch der eigentlichste theil des amts der schösser weggefallen. NIEBUHR röm. gesch.3 1, 464;
ein weisze mausz, war sein mundschenck,
ein aff, sein schösser wolgelenck.
ROLLENHAGEN froschm. F 1b;
schösser, die in ämtern dienen.
LOGAU 2, 241, 194;
ist es kein superintendent,
so mags ein küster seyn,
und ists kein schösser der mich kennt,
so mags ein schreiber sein.
WEISE cur. gedanken s. 7. 2) schosser, die bäckerschaufel, womit die bäcker den geformten teig in den ofen schieben (schieszen); s. schosse 1. schöszer PFISTER 267. 3) schösser, hänfling, s. schösserlein. 4) schosser, schösser, spielkügelchen der kinder (s. schusser) FRISCH 2, 221c; mit schössern, hinckers, löpers. COMENIUS sprachenth. (1657) 941; eine schachtel mit schossern für die kinder. GÖTHE an Knebel 227. schosser, schossers PFISTER 267.
Leberecht
Da es in diesem alten Buch ja als etwas "besonderes" eingetragen ist, nehme ich an, dass es sich bei diesem Schösser tatsächlich um eine Art Steuereinnehmer handeln muss.

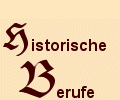




Kommentar