Mongolische Kirche
moni
hat jemand schon mal was von der mongolischen Kirche gehört? Steht in der Geburtsurkunde meines Großvaters als Religion, kann damit überhaupt nichts anfangen.
Sokke
es gibt mittlerweile eine christliche Kirche in der Mongolei, auch mongolische Kirche genannt. Heute gehören ihr ca. 0,71% der Bevölkerung an. Allerdings ist diese Entwicklung erst nach 1989 eingetreten. Daher scheint es mir wirklich eine Fehlinterpretation zu sein.
Auszug aus www.Mission.ch
Religion:
Nichtreligiöse / Andere 41,59%
Schamanisten 31,20 %
Buddhisten 22,50%
Muslime 4,00 %
Christen 0,71 % (katholisch 0,03 %
reformiert 0,41 %
freikirchlich 1,00 % (übergreifend))
Der lamaistische Buddhismus, Schamanismus und Islam sind als Hauptreligionen anerkannt, aber auch für alle anderen gibt es eine gewisse Religionsfreiheit. Einschränkungen gibt es für „ausländische Religionen“, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit gesehen werden.
moni
hat jemand schon mal was von der mongolischen Kirche gehört? Steht in der Geburtsurkunde meines Großvaters als Religion, kann damit überhaupt nichts anfangen.
Sokke
es gibt mittlerweile eine christliche Kirche in der Mongolei, auch mongolische Kirche genannt. Heute gehören ihr ca. 0,71% der Bevölkerung an. Allerdings ist diese Entwicklung erst nach 1989 eingetreten. Daher scheint es mir wirklich eine Fehlinterpretation zu sein.
Auszug aus www.Mission.ch
Religion:
Nichtreligiöse / Andere 41,59%
Schamanisten 31,20 %
Buddhisten 22,50%
Muslime 4,00 %
Christen 0,71 % (katholisch 0,03 %
reformiert 0,41 %
freikirchlich 1,00 % (übergreifend))
Der lamaistische Buddhismus, Schamanismus und Islam sind als Hauptreligionen anerkannt, aber auch für alle anderen gibt es eine gewisse Religionsfreiheit. Einschränkungen gibt es für „ausländische Religionen“, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit gesehen werden.






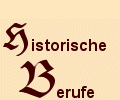
Kommentar