Kretschmer / Schenker
In meinen Unterlagen tauchen die Begriffe
Kretschmer , Erbkretschmer und Schänker auf.
henrywilh
Zu Frage 1 brauchst du nur zu googlen, da findest du's!

Und: Schänkerin ist gewiss die Frau.
Laurin
Zur Ergänzung:
tschech. krčmář (gespr. etwa Krtschmaarj) "Schankwirt = Kretschmer"
In zweisprachigen bzw. slaw. geprägten / beeinflußten Gegenden gleichzeitig nebeneinander verwendet, auch als Familienname.
Der Erbkretschmer war ein Erbpächter des Gasthofes / Kretscham, d.h. nach dessen Tod ging das Schankrecht auf seinen (ältesten) Nachkommen über
und dieser war somit der neue Erbkretschmer.
Jahr, aus dem der Begriff stammt: 1850-1870
Region, aus der der Begriff stammt: Schlesien
Region, aus der der Begriff stammt: Schlesien
In meinen Unterlagen tauchen die Begriffe
Kretschmer , Erbkretschmer und Schänker auf.
- Ist der Erbkretschmer der älteste Sohn des Kretschmers?
- Kann man davon ausgehen das der Schänker trotzdem ein Nachfolger (Erbe/Kind) des Kretschmers ist. Familienname ist gleich und das Dorf hatte nur ca. 100 Einwohner.
- Und die Frage die sich daran anschliesst ist die Schänkerin eher die Frau des Schänkers oder könnte sie eine Tochter/Erbin des Schänkers sein.
henrywilh
Zu Frage 1 brauchst du nur zu googlen, da findest du's!
Und: Schänkerin ist gewiss die Frau.
Laurin
Zur Ergänzung:
tschech. krčmář (gespr. etwa Krtschmaarj) "Schankwirt = Kretschmer"
In zweisprachigen bzw. slaw. geprägten / beeinflußten Gegenden gleichzeitig nebeneinander verwendet, auch als Familienname.
Der Erbkretschmer war ein Erbpächter des Gasthofes / Kretscham, d.h. nach dessen Tod ging das Schankrecht auf seinen (ältesten) Nachkommen über
und dieser war somit der neue Erbkretschmer.







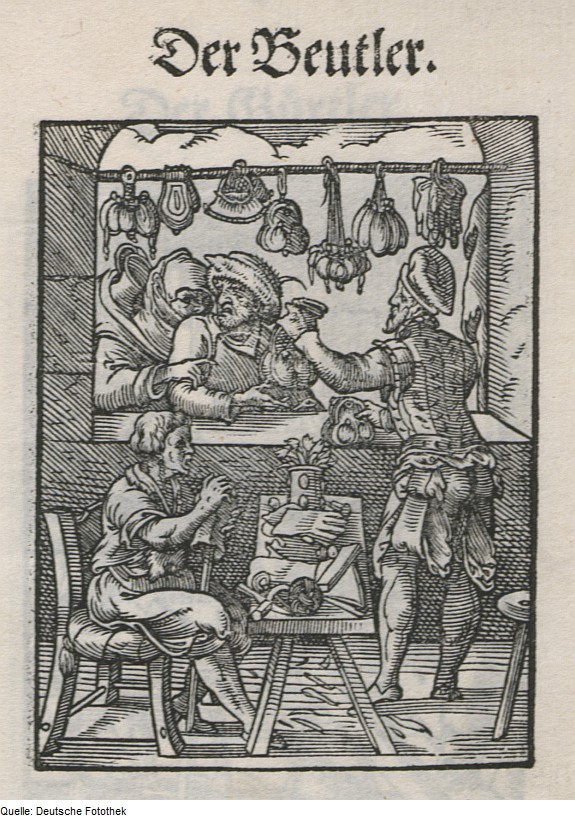





Kommentar